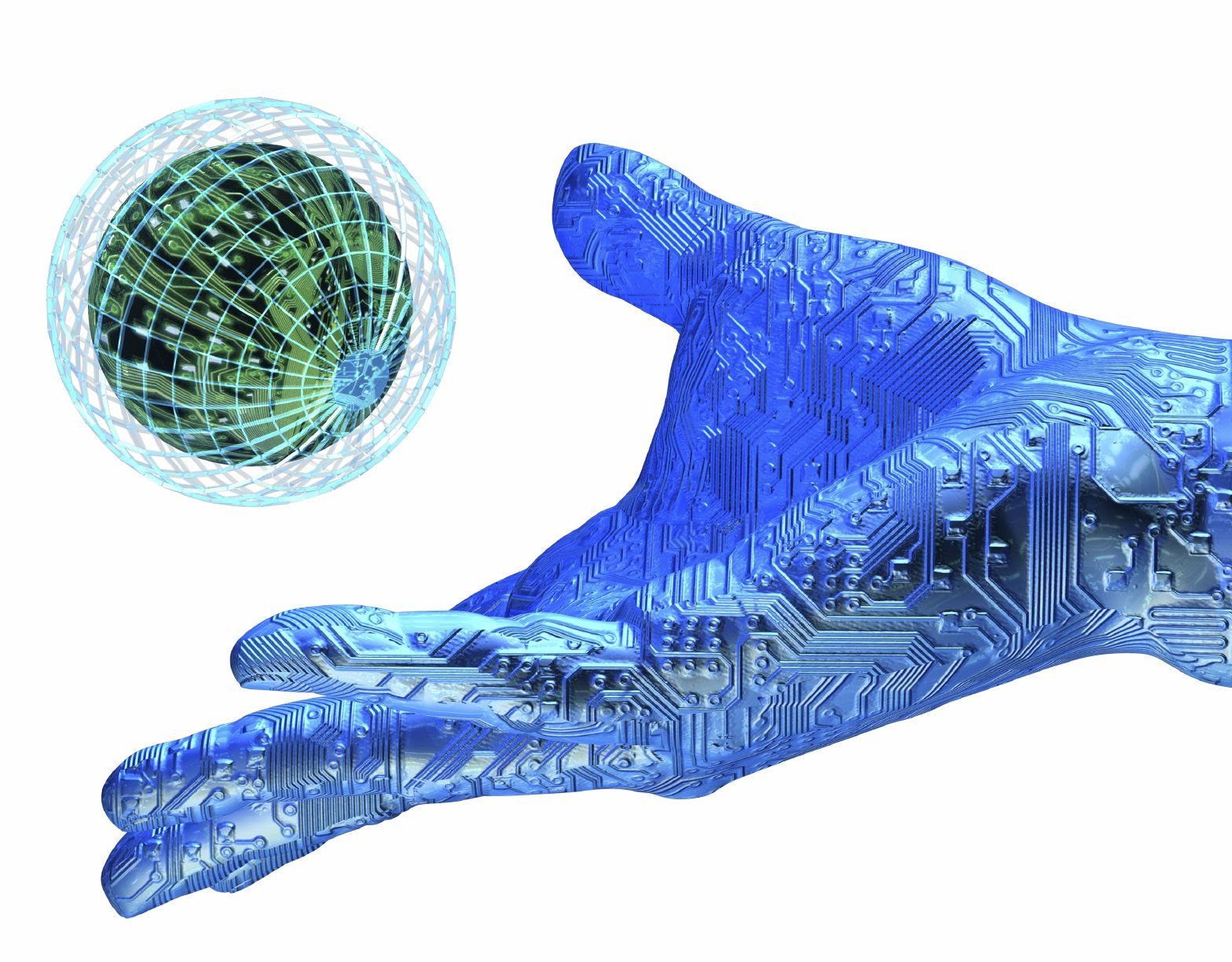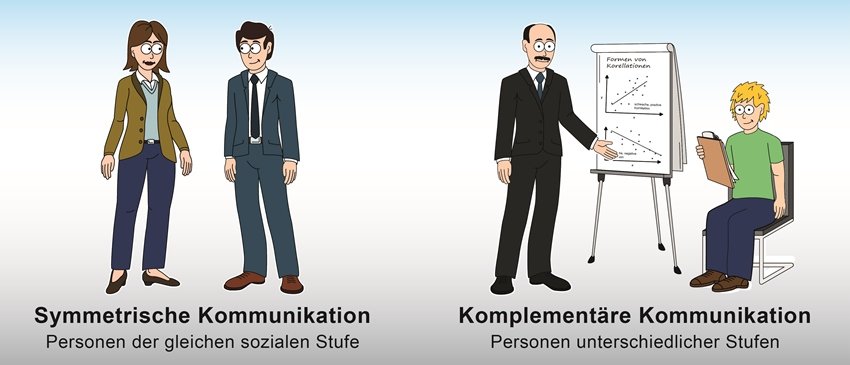Frischer Wind durch interne Audits
„Schatz, wir müssen reden!“
In den 30 Jahren unserer Beziehung mit ISO 9001 hat sich vielerorts Routine eingeschlichen, ist die Spannung raus, sind die tief hängenden Früchte geerntet. Der Blick hat sich vielfach auf die Notwendigkeiten, auf Pflichtfüllung, hat sich auf Fehlersuche und Schwächen fokussiert. Lästige Pflichtübung, ritualisiertes Abfragespiel, Sägezahnveranstaltung, kollektives Checklistenbefüllen für die Einen, Monitoring der Wirksamkeit des Managementsystems, einzigartige Performancemessung im QM, Lebenselixier des Qualitätsgedankens für die Anderen – kaum ein Instrument wird so kontrovers beschrieben wie interne Audits.
Dabei scheint alles so einfach: ISO 9001 (9.2) fordert in geplanten Abständen ein internes Auditprogramm inkl. Kriterien, Umfang, Methoden, Berichterstattung und Maßnahmenverfolgung zur Klärung der Angemessenheit und Wirksamkeit des Managementsystems. ISO 19011 (5.1) empfiehlt Art, Größe, Besonderheiten, Funktionalität, Komplexität und Reifegrad der Organisation zu berücksichtigen, wenn Dinge von Bedeutung risikobasiert begutachtet werden. In der Praxis finden Auditoren statt eines solchen Auditprogramms häufig jedoch nur einen Terminplan vor.
5 Why
Warum? Offensichtlich herrscht oft extrinsische Motivation in Form von ‚Zertifikatsdruck‘ vor, d.h. eigenes Interesse am Auditprozess wäre nicht gegeben. Warum? Neurologen sagen uns, dass es am Belohnungsversprechen liegen muss, was hieße: Ein Sinn wird nicht erkannt. Warum? Weil die bisherige Auditroutine keine Ergebnisse gezeigt hat, die als sinnstiftend bemerkt worden wären. Warum? Weil fehlendes gemeinsames Verständnis einer Qualitätskultur zu ‚low involvement qm‘ geführt hat. Warum? Weil das Vorgehen im QM – einschließlich interner Audits – den formulierten Ansprüchen der Disziplin oft nicht gerecht wird. Gleichen Sie Ihre Erfahrung mit internen Audits an den sieben QM-Prinzipien ab, werden Mankos in Sachen KVP, Einbeziehung von Personen, faktengestützter Entscheidungsfindung und Commitment der Führung schnell sichtbar. Am stärksten jedoch fehlen oft Kunden- und Prozessorientierung.
Kundenorientierung
„Wann wurde bei ihnen zuletzt ein Audit bestellt?“ Wer auf diese Frage keine Antwort hat ist an einem guten Startpunkt für die Renaissance der internen Audits. Wie immer im QM ist die Frage ‚Für wen machen wir das hier?‘ der entscheidende Punkt. Die Bedürfnisse des Kunden, seine Anforderungen, seine Wahrnehmung der Qualität des Ergebnisses des Auditprozesses sind entscheidend. Ist offen oder verdeckt klar „wir machen das doch nur für den Zettel an der Wand“ kann man a) sich verweigern oder b) das Beste draus machen. Womit könnten wir diesen internen Kunden begeistern? Bleibt die Frage im Planungsgespräch unbeantwortet, bleibt nur Plausibilität im Vorgehen. Was wäre zuträglich, unterstützend, schwellensenkend, bereichernd, konsistenzfördernd? Womit können Fehler vermieden, Schnittstellen geheilt, Klarheit geschaffen werden? Daraus lassen sich bei fehlendem Auftrag geeignete Auditziele und Vorgehen ableiten. Dennoch: oft reicht ein Gespräch, um einen Auditauftrag einer verantwortlichen Team-, Bereichsleitung ider der Geschäftsführung zu erhalten. Die Erfahrung zeigt, dass viel zu oft einfach nur Niemand an diese Möglichkeit gedacht hat.
Prozessorientierung
Typisch vor Implementierung eines QM-Systems sind Stärken im Do, hinreichender Plan, schwache Ausprägung des Check und kaum Impulse für neues Agieren. So auch im Auditprozess. Wird das Vorgehen aus dem (ggf. nur unterstellten) Kundenwunsch abgeleitet und im Audit umgesetzt Bedarf es im Nachgang kritischer Betrachtung und Aufnahme der gelernten Lektionen. Vielfach sind es jedoch nur die tradierten Vorgehensweisen (Vorgabengestütztes Interview „Wie stellen Sie sicher, dass…?“), die einen Erfolg beeinträchtigen. Was bei der qualitätssichernden ‚Kontrolle‘ am Werkerarbeitsplatz 1987 vielleicht noch geeignet war taugt heute in Arbeitsgruppen/Projektteams oder gar agilen Zusammenhängen kaum, um die Angemessenheit der Vorgaben und die Wirksamkeit des Leitens und Lenken zu begutachten. Fragen Sie Ihre engsten Vertrauten in Sachen interne Audits einmal nach Alternativen zum checklistengestützten Interview – da tut sich ein Handlungsfeld auf.
Blitzlicht/Tablet-Audits/Quiz
Aus Umweltmanagement und Arbeitssicherheit bzw. Ordnung und Sauberkeit (5S) ist bekannt, dass auch bloß situative Beobachtungen zusammengetragen und dokumentiert werden. Feststellungen, Dokumentation (oft Foto der Beobachtung) und Maßnahmenverfolgung können insgesamt auch im QM als Bestandteil eines Auditprogramms angesehen werden. An reinen Büroarbeitsplätzen fällt dies schwer. Da ist aber Beispielsweise an die Kopplung von Zugangskontrollen und Beantwortung von Managementsystemfragen (Flur-Quiz beim ersten Weg am Vorzimmer vorbei, Datensicherheit/Kopierer, Führerscheinkontrolle/Poolfahrzeug, PSA/Arbeitsbereich, Kalibrierung/Werkzeugausgabe) zu denken.
Top/Flop-Audit
Guter Zusammenarbeit förderlich und trotzdem oft erkenntnisreich ist eine Absprache, nach der an den einzelnen Stationen des Audits ein Auftrag begutachtet wird, bei dem alles wie geplant lief bzw. sogar begeisterte Kundenreaktion kam (Top) und einem, der nicht direkt zum Wunschergebnis geführt hat (Flop). Allein die Gegenüberstellung der Unterschiede lässt oft gemeinsam Schwachstellen im Ablauf erkennen und legt Maßnahmen nahe.
Rückwärts auditieren
Oft wird abteilungsweise anhand Vorgabedokumente eine betriebliche Handlung begutachtet. Das kann mit neuen Arbeitnehmern oder in neue beschriebenen Prozessen ganz aufschlussreich sein – führt aber fast konsequent zum Wunschergebnis. Rückwärts, beginnend bei einem N-I-O-Teil aus dem Sperrlager bzw. einer Reklamation kommt man Abweichungen vom geplanten Prozess (‚eigentlich sollten wir ja, aber…‘) oder unbeherrschten Phasen eines Prozesses auf die Spur.
Stellvertreteraudit
Eine angemessene Stellvertreterregelung ist Pflicht. Ob das spezifische Wissen der Organisation zur Verfügung steht oder nur zwischen den Ohren der Mitarbeiter steckt, bekommt man mit einem internen Audit heraus, das nur über die Stellvertreterpositionen geht. Vielleicht erkennen Sie dabei, dass nicht für alle Aufgaben Vertreter benannt sind, dass Teilaufgaben sehr stark von einzelnen Personen abhängig sind oder dass benannte Stellvertreter nicht hinreichend mit der Aufgabe vertraut sind oder dass einfach Zugriffsrechte fehlen. Überraschung fast garantiert.
Interne Kunden-Lieferanten-Audits
Abteilungs-, Disziplin- oder physische Arbeitsplatzgrenzen schaffen oft Schnittstellen, die für Friktionen im Prozess sorgen. Unabhängig davon, ob eher die Kommunikation oder die echte Auftragsbearbeitung betroffen ist, schaffen moderierte schnittstellenübergreifende ‚Auditgespräche‘ häufig eine neue Grundlage der reibungslosen Zusammenarbeit. „Ach so macht ihr das“, „Ach dafür braucht Ihr das“, „Und wir dachten immer, dass…“ können zu Neufestlegungen führen, die als Dokumentation des Audits gelten können.
Prozessaudit am Turtle entlang
Bei vielen an einem Prozess Beteiligten schafft der Gesamtblick auf den Prozess häufig ein gemeinsames Verständnis. Wer ist der Kunde des Prozesses, was braucht der, was ist also das festgelegte Ergebnis des Prozess(schritt)es? Welche Eingaben bedingt dies, welche Methoden, Maschinen, Menschen (Kompetenzen), Messungen Spezifikationen, Prozessleistung)? Fazit: Mit dem Turtle gelingt es leicht, die Wirksamkeit im Sinne des QM in den Vordergrund zu stellen und sich nicht zu schnell in die Details der Arbeit zu verlieren. Das Turtle gibt dazu wesentliche Aspekte (und damit Fragen) zur Steuerung und zur Zusammenarbeit an den Schnittstellen vor.
Selbstbewertung
Mehr Vorbereitung erfordert aber fundierte Ergebnisse bringt ein Workshop, in dem die zu einem Item (Prozess, Entwicklungsschritt, Veränderung, Herausforderung…) aussagefähigen Mitarbeiter vorab eine Selbsteinschätzung abgeben und das Ergebnis vorgestellt und moderiert wird. Das ist sehr erhellend aber effizient, weil nur über Dinge gesprochen wird, bei denen die Einschätzungen weit auseinanderliegen (2 Schulnoten, >20% oder dergl. angemessene Spanne). Um valide Ergebnisse zu erzielen bietet es sich an, an bewährten Selbstbewertungsschemata angelehnt vorzugehen, etwa dem Anhang A der ISO 9004 oder den Teilkriterien des EFQM-Modells. Hauptpunkte, Ideen und Risiken werden festgehalten (Doku!), Maßnahmen noch im Workshop beschlossen oder Erarbeitung an Teilgruppe delegiert (wer, bis wann, was…).
Retrospektive
Wenn wir das interne Audit einmal als Feedback-Methode sehen, dann wird deutlich, dass es in vielen Organisationen schon Ansätze gibt, die wichtige Facetten des internen Audits abdecken. Ein wertvolles Feedback-Instrument für Teams ist die Retrospektive, weil hier neben den sachbezogenen Aspekten auch Fragen der Zusammenarbeit adressiert und gelöst werden können.
Im Ursprung kommt diese Methode aus der IT. Dort gibt es den Ansatz der Retrospektive neben dem agilen Projektmanagement (Scrum). Retrospektiven sind Teamtreffen, bei denen es darum geht, aus der Vergangenheit zu lernen. Gemeinsam schauen die Teammitglieder auf die letzten 2, 3 oder 4 Wochen zurück und bewerten, was gut und was schlecht gelaufen ist. Sie versuchen zudem zu analysieren, was die Gründe dafür sind und kommen damit dann zu Verbesserungsmaßnahmen.
Und weil eine Retrospektive von einer neutralen Person moderiert werden kann, lässt sich im Grunde auch diese Anforderung aus der Ecke klassischer Audits erfüllen.
Ein Unterschied ist, dass eine solche Retrospektive nicht in oder zweimal im Jahr gemacht wird sondern (siehe oben) vielleicht alle 2 oder 4 Wochen. Dafür ist der zeitliche Rahmen klein und der Fokus liegt auf kleinen und konkreten Maßnahmen, die ein Team direkt umsetzen kann. Also nicht mehr quatschen sondern einfach machen. Beim Folgetermin reflektiert man dann die selbst vereinbarten Maßnahmen und prüft, ob sie funktionieren und ob sie dauerhaft übernommen werden.
Weitere Informationen
Die meisten der oben skizzierten Methoden finden Sie ausführlich beschrieben in dem DGQ-Whitepaper „Interne Audits – nicht von gestern“ auf unserer Themenseite „Audit“.
Eigentlich könnten wir das ja mal probieren
Gibt es einen besseren Zeitpunkt, als während der Transition? Die Revision der Kernnormen gibt Anlass, etliche Aspekte neu aufzuarbeiten (Kontext/interessierte Parteien, Konsistenz QM/Strategie, Risikobasierung, Wissensmanagement, Führungsverhalten, Prozessmanagement, Lieferantenmanagement, Freiheiten in der Dokumentation …).
Genau der richtige Zeitpunkt, um die internen Audits neu aufzustellen finden
Michael Weubel + Kai-Uwe Behrends
Über die Autoren
 |
 |
| Kai-Uwe Behrends ist seit 2005 Leiter der DGQ-Landesgeschäftsstelle Nord in Hamburg. Vorher war der studierte Diplom-Volkswirt und -Sozialökonom Fachbereichsleiter und Qualitätsmanagement-Beauftragter einer Bildungseinrichtung mit 100 Mitarbeitern. Er ist Auditleiter der DQS für ISO 9001 und AZAV. | Nach einer Ausbildung zum Fluggerätmechaniker und Maschinenbaustudium war Michael Weubel als Qualitätsingenieur tätig. Nach seinem Wechsel zur DGQ übernahm er neben der Rolle des QMB auch Verantwortung für den Ausbau des Angebots von Inhousetrainings und die Leitung der Landesgeschäftsstelle Mitte. Seine Erfahrungen, auch aus DQS-Audits, stellt er seit 2015 als Key Account Manager den Kunden der DGQ Weiterbildung GmbH zur Verfügung. |
Der Beitrag Frischer Wind durch interne Audits erschien zuerst auf DGQ Blog.